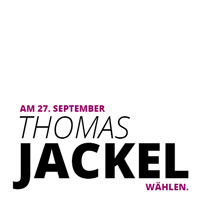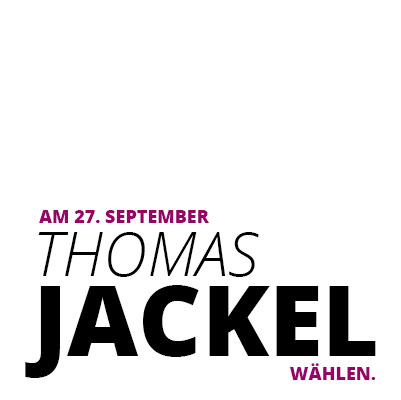Mein beruflicher Werdegang
Erfahrung aus der Verwaltungspraxis
Durch eine Zeitungsannonce wurde ich auf ein Angebot der Stadt Frankfurt aufmerksam, die Abiturienten für die so genannte Inspektor- Laufbahn suchte („Diplom – Verwaltungswirt“). Das Angebot und die Vielfältigkeit der Einsatzgebiete in Frankfurt sprachen mich an. Nach einem erfolgreichen Einstellungstest absolvierte ich dann von 1979 bis 1982 meine Ausbildung für den gehobenen nicht technischen Verwaltungsdienst, die ich mit der Gesamtnote „gut“ abschloss.
Die erste Station nach meiner Ausbildung war dann das Kassen- und Steueramt der Stadt Frankfurt, wo ich mit der Veranlagung von Grundsteuern, Müll- und Straßenreinigungsgebühren betraut war. In dieser Zeit habe ich eine Menge über Satzungs- und Gebührenrecht gelernt. Ein Wissen, dass mir gerade jetzt als Gemeindevertreter sehr nützlich und hilfreich ist.
Nach einem internen Wechsel in die Haushaltsabteilung der Stadtkämmerei vertraute man mir nach kurzer Zeit das so genannte Zentralreferat an, in dem die übergreifenden und koordinierenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung und der Ausführung der Haushaltspläne der Stadt Frankfurt angesiedelt waren. Die Übernahme dieser Aufgabe war mit einem Aufstieg in den höheren Verwaltungsdienst und mit Führungsverantwortung in größerem Umfang verbunden.
Das Generieren von Kennzahlen zur Steuerung und quer über alle Bereiche des kommunalen Handelns hat mir einen sehr weitgehenden und tiefen Einblick in fast alle öffentlichen Themenfelder gebracht.
Das Modell wird bis heute in Frankfurt mit Erfolg und großer Akzeptanz der Verwaltungsbereiche und der Politik praktiziert. Seine wesentlichen Bestandteile fanden später Eingang in die Hessische Gemeindehaushaltsverordnung und wurden bindend für alle Hessischen Kommunen.
 Im Jahr 2001 wurde ich von dem damaligen Dezernenten Nikolaus Burggraf darauf angesprochen, ob ich mir vorstellen könne, als Verwaltungsleiter zur Berufsfeuerwehr Frankfurt zu wechseln. Die Feuerwehr stand damals vor großen Herausforderungen. Ihre Gebäude waren in einem sehr schlechten Zustand und lagen an Stellen im Stadtgebiet, die einsatztaktisch zum großen Teil ungeeignet waren. Zudem waren die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt wieder einmal alles andere als gut. Er suchte daher eine Führungskraft, die mit unkonventionellen Methoden und Ideen zu Lösungen kommt.
Im Jahr 2001 wurde ich von dem damaligen Dezernenten Nikolaus Burggraf darauf angesprochen, ob ich mir vorstellen könne, als Verwaltungsleiter zur Berufsfeuerwehr Frankfurt zu wechseln. Die Feuerwehr stand damals vor großen Herausforderungen. Ihre Gebäude waren in einem sehr schlechten Zustand und lagen an Stellen im Stadtgebiet, die einsatztaktisch zum großen Teil ungeeignet waren. Zudem waren die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt wieder einmal alles andere als gut. Er suchte daher eine Führungskraft, die mit unkonventionellen Methoden und Ideen zu Lösungen kommt.
Das war genau die Art Aufgabe, die mich schon immer angesprochen und gereizt hat. Gemeinsam mit einem Kollegen der Einsatzabteilung entwickelten wir das „Taktische Feuerwehrkonzept 2020“. Meine Aufgabe war es dabei, die Anzahl der Feuerwachen von 7 auf 12 zu erhöhen und die dafür notwendigen Grundstücke und Gebäude zu beschaffen und zu bauen. Außerdem musste die Vorhaltung und Beschaffung von Ausrüstung, Fahrzeugen und feuerwehrtechnischem Gerät auf die neue Struktur angepasst werden. Das hierfür notwendige Investitionsvolumen lag bei rd. 150 Mio. €.
Als privatrechtlich organisiertes Unternehmen hat die Gesellschaft aber viel flexiblere Möglichkeiten, am Markt zu agieren. So werden z. B. Architekten- und Fachplanungsleistungen nicht immer wieder neu vergeben. Die Gesellschaft greift stets auf einen kleinen, aber bewährten Kreis von Architekten und Ingenieuren zurück, die die Materie kennen. Dies hilft teure Planungsfehler zu vermeiden.
Der Gesellschaft wurden zunächst die Bestandsgebäude übertragen. Objekte, die für Feuerwehrzwecke nicht oder nicht mehr infrage kamen und kommen, werden vermarktet. Dabei werden Grundstücke auch selbst, z. b. für den Wohnungsbau, entwickelt, was zu höheren Veräußerungserlösen führt. Diese Mittel werden zur Teilfinanzierung der neuen Feuer- und Rettungswachen eingesetzt. Im Übrigen refinanziert sich die Gesellschaft am Kapitalmarkt als 100% Tochter der Stadt zu deren (günstigen) Konditionen.
Die Feuerwehr zahlt an die Gesellschaft eine Kostenmiete, die sich aus der Abschreibung der Gebäude und den Fremdkapitalzinsen zusammensetzt. Damit tilgt die Gesellschaft die aufgenommenen Kredite und bildet einen Kapitalstock, der sie in die Lage versetzt, ohne weitere Belastung des städtischen Haushalts zum gegebenen Zeitpunkt die Feuer- und Rettungswachen zu erneuern. Damit ist die Infrastruktur der Feuerwehr in Frankfurt unabhängig vom städtischen Haushalt geworden.
Dieses Modell findet mittlerweile Anerkennung und Beachtung in ganz Deutschland.
 Nach dessen Implementierung wurde auch die organisatorische Struktur der Branddirektion angepasst. Es wurden zwei Direktionsbereiche gebildet, wobei die Leitung des Direktionsbereichs „Infrastruktur“ mir anvertraut wurde. Zu meinem Aufgabenbereich gehören 3 Abteilungen, von denen sich die erste mit der Beschaffung und Instandsetzung von Fahrzeugen, feuerwehrtechnischem Gerät und persönlicher Schutzausrüstung beschäftigt. Ihr sind auch die Fahrzeugwerkstatt und verschiedene Prüfeinrichtungen für technisches Gerät zugeordnet.
Nach dessen Implementierung wurde auch die organisatorische Struktur der Branddirektion angepasst. Es wurden zwei Direktionsbereiche gebildet, wobei die Leitung des Direktionsbereichs „Infrastruktur“ mir anvertraut wurde. Zu meinem Aufgabenbereich gehören 3 Abteilungen, von denen sich die erste mit der Beschaffung und Instandsetzung von Fahrzeugen, feuerwehrtechnischem Gerät und persönlicher Schutzausrüstung beschäftigt. Ihr sind auch die Fahrzeugwerkstatt und verschiedene Prüfeinrichtungen für technisches Gerät zugeordnet.
Zur zweiten Abteilung gehören die vertraglichen und juristischen Angelegenheiten, das Vergabewesen, der komplette Personalservice, das Finanzwesen und der Träger des Rettungsdienstes, der sich um die Notfallrettung in Frankfurt kümmert.
Die dritte Abteilung kümmert sich um die vollständige Informations- und Kommunikationstechnik der Feuerwehr, die wegen der besonderen Anforderungen insbesondere im Hinblick auf Ausfallsicherheit weitgehend autark und unabhängig von den übrigen städtischen Einrichtungen betrieben werden muss.
Bis heute obliegt mir die Leitung dieses Direktionsbereichs als stellvertretender Amtsleiter der Branddirektion im Range eines Leitenden Magistratsdirektors.